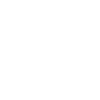Über Verlust, Schmerz, offene Wunden und das Gefühl, nicht mehr zu können.
Meine Oma ist vor einer Woche gestorben.
Ein Mensch, der mich mein Leben lang begleitet hat. Ihre ruhige Stimme, ihr „Guten Morgen, Anni“ – das war mehr als nur ein Satz. Es war Sicherheit. Wärme. Ein Stück Zuhause. Seitdem ist alles anders.
Meine Welt steht still.
Aber außen läuft alles weiter. Die Kinder wollen ständig etwas von mir.
Der Haushalt ruft. Das Handy klingelt. Arzttermine, Verantwortung, Alltag, funktionieren.
Und ich? Ich würde einfach nur gern kurz verschwinden.
In eine Decke gewickelt, mit der Stimme meiner Oma im Ohr.
Nur für einen Moment. Einfach nur Enkelin sein, einfach nur Mensch sein.
Keine Mutter. Keine, die alles regelt. Keine, die funktioniert.
Und als wär das nicht genug – mein Körper rebelliert.
Letzten November hatte ich einen Fahrradsturz. Die Diagnose: Schulterbruch.
Und was dann kam, war nicht nur Schmerz – es war ein zermürbender Kampf.
Monatelange Physiotherapie. Ärzte, die nicht genau hinschauen. Verharmlosung.
Immer wieder das Gefühl: „Stell dich nicht so an.“ Ich musste kämpfen. Für ein MRT.
Für klare Aussagen. Für ernst genommen werden.
Erst im Juni – über ein halbes Jahr später – dann die OP.
Und ich dachte: „Okay, jetzt beginnt die Heilung.“ Aber jetzt?
Die Narbe ist wieder aufgegangen. Sie eitert. Sie brennt.
Und ich will einfach nur schreien:
„Wie lange noch soll ich das alles aushalten?!“
Ich bin traurig. Ich bin müde. Nicht nur körperlich. Sondern tief in meiner Seele.
Ich spüre, dass meine Kinder meine Überforderung merken.
Ich merke, dass ich ihnen gerade nicht so viel Nähe geben kann wie sonst.
Und das tut weh.
Genauso wie die Stille, die meine Oma hinterlassen hat. Ich vermisse sie.
Ich will sie anrufen. Ich will noch einmal hören, wie sie meinen Namen sagt.
Stattdessen kündige ich ihre Verträge, während mein Herz noch nicht einmal realisiert
hat, dass sie wirklich weg ist.
Und trotzdem… steh ich noch.
Wacklig. Erschöpft. Offen. Aber ich steh. Nicht, weil ich so stark bin.
Sondern weil ich es nie gelernt habe, nicht stark zu sein.
Aber ich hab keine Lust mehr, nur zu funktionieren.
Ich will fühlen. Ich will traurig sein dürfen. Ich will laut sein.
Ich will nicht mehr alles alleine tragen.
Diese Narbe auf meiner Schulter ist nicht nur eine Wunde.
Sie ist ein Symbol für alles, was ich durchgemacht habe.
Sie zeigt, was unter der Oberfläche noch offen ist:
Nicht nur Haut, sondern Herz. Und vielleicht ist genau jetzt der Moment, in dem ich
aufhöre, zu warten, dass jemand mir erlaubt zu pausieren.
Vielleicht geb ich mir diese Erlaubnis jetzt einfach selbst.
Wenn du das hier liest und du fühlst dich ähnlich – so, als würdest du innerlich
stehen, während außen alles weiterläuft – dann will ich dir sagen:
Du bist nicht allein.
Du bist nicht schwach.
Du bist nicht falsch. Du bist einfach müde vom aushalten.
Und du darfst dich jetzt selbst in den Arm nehmen.
Mit allem, was noch offen ist.
Ich bin noch nicht geheilt, aber schon längst echt.
Und genau deshalb schreibe ich das –
weil ich keine Lust mehr habe, nur stark zu wirken.
Ich will einfach ich sein. Mit Narben. Mit Schmerz. Mit Herz. 🖤